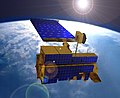ICESat
- Seiten mit Skriptfehlern
- Wikipedia:Satellit mit Bildgröße
- Wikipedia:Veraltet nach Jahr 2016
- Erdbeobachtungssatellit
- NASA
- Earth Observing System
- Raumfahrtmission 2003
| ICESat | |
|---|---|
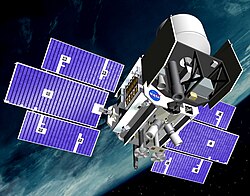
| |
| Typ: | Erdbeobachtungssatellit |
| Land: | |
| Betreiber: | NASA |
| COSPAR-ID: | 2003-002A |
| Missionsdaten | |
| Start: | 13. Januar 2003, 00:45 UTC |
| Startplatz: | Vandenberg SLC-2W |
| Trägerrakete: | Delta 7320-10 D294 |
| Status: | abgestürzt am 30. August 2010 |
| Bahndaten | |
| Umlaufzeit: | 96,6 min[1] |
| Bahnneigung: | 94° |
| Apogäumshöhe: | 610 km |
| Perigäumshöhe: | 593 km |
ICESat (Ice, Cloud and Land Elevation Satellite), Teil des NASA-Erdbeobachtungssystems, ist der Name einer Satellitenmission zur Ermittlung von Eispanzerdicken, deren Veränderung, der Messung von Höhenprofilen von Wolken und Aerosolen sowie der Höhe der Vegetation und der Meereisdicke. Das wichtigste Instrument an Bord war das Geoscience Laser Altimeter System (GLAS), das vom Goddard Space Flight Center entwickelt wurde.
Missionsverlauf
ICESat wurde am 13. Januar 2003 mittels einer Boeing Delta II-Rakete von der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien auf eine nahezu kreisförmige Bahn geschossen, die die beiden Polregionen überspannt. Die Höhe der Bahn lag nach dem Start bei 600 km.[1]
Die ersten Messungen wurden am 20. Februar 2003 durchgeführt. Schon am 29. März versagte der erste der drei Laser, so dass die Einsatzzeiten umgeplant werden mussten.[2] In den nächsten Jahren wurden 15 Messkampagnen durchgeführt, bis am 11. Oktober 2009 der letzte Laser versagte. Die Bemühungen, ihn wieder zu aktivieren, wurden im Februar 2010 eingestellt.[3]
Zwischen dem 23. Juni und dem 14. Juli verringerte die NASA die Bahnhöhe des Satelliten schrittweise auf 200 km, um die Lebensdauer zu verringern. Am 14. August 2010 wurden alle Systeme abgeschaltet, nachdem auch der restliche Treibstoff verbraucht worden war. Am 30. August trat ICESat in die Atmosphäre ein und verglühte größtenteils. Einige Trümmer stürzten gegen 09:00 UTC in die Barentssee.[4]
Nachfolger
Das Nachfolgemodell ICESat-2 soll 2016veraltet den Betrieb aufnehmen.[5] Im Gegensatz zu ICESat sollen dann mehrere Laser gleichzeitig zum Einsatz kommen, damit Geländeformen schon während eines einzigen Umlaufs erkannt werden können.[6]
Weblinks
- NASA: ICESat (englisch)
- Goddard Space Flight Center ICESat & ICESat-2 (englisch)
- Center for Space Research, University of Texas: ICESat/GLAS (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ 1,0 1,1 Bahndaten nach Mark Wade: ICESat. In: Encyclopedia Astronautica. 17. November 2011, abgerufen am 10. September 2012 (englisch).
- ↑ B. E. Schutz et al: Overview of the ICESat Mission. (PDF) In: Geophysical Research Letters Vol. 32. 2. November 2005, abgerufen am 10. September 2012 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 149: attempt to index field 'data' (a nil value)).
- ↑ Kathryn Hansen: ICESat's Notable Moments in Science. NASA, 24. Februar 2010, abgerufen am 10. September 2012 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 149: attempt to index field 'data' (a nil value)).
- ↑ Sarah DeWitt: NASA's Successful Ice Cloud and Land Elevation Mission Comes to an End. NASA, 30. August 2010, abgerufen am 10. September 2012 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 149: attempt to index field 'data' (a nil value)).
- ↑ Michael Studinger: Eisberg von Größe New Yorks entsteht in Antarktis. AFP, 4. November 2011, abgerufen am 10. September 2012.
- ↑ ICESat-2. NASA, 13. August 2012, abgerufen am 10. September 2012 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 149: attempt to index field 'data' (a nil value)).