Menschen
Der Mensch (Homo) ist heute der einzigste Überlebende eines einst artenreichen Stamms von ständig aufrecht gehenden Primaten aus der Familie Hominidae.
DNA-Untersuchungen sowie fossile Belege deuten darauf hin, dass der moderne Mensch (Homo sapiens) vor etwa 200.000 Jahren in Ostafrika entstand.
Im Vergleich zu anderen Primaten haben Menschen (Homo) ein hoch entwickeltes Gehirn, das abstraktes Denken sowie Sprache und komplexe Problemlösungen ermöglicht. Diese geistigen Fähigkeiten sind einzigartig in der Tierwelt und kombiniert mit dem aufrechten Gang, der die Hände für mannigfaltige Aufgaben frei macht, ermöglichten sie es den Frühmenschen vor bereits 2,5 Millionen Jahren eine Werkzeugtechnologie zu entwickeln, die es seinesgleichen im Tierreich nicht wieder gibt.
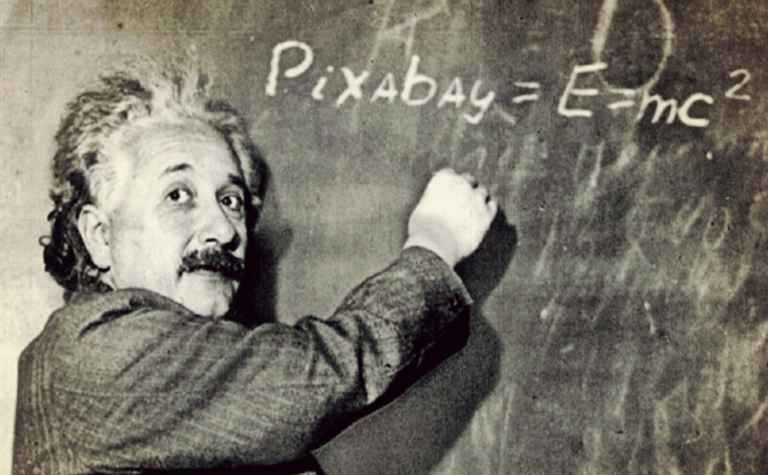
Das Verbreitungsgebiet der Menschen dehnt sich heute über die meisten Kontinente der Erde aus. Im Februar 2009 betrug die Zahl der Menschen auf der Erde 6,7 Milliarden Individuen.
Wie die meisten höheren Primaten verfügen Menschen (Homo) über eine komplexe Sozialstruktur. Menschen können vor allem aufgrund ihrer hochentwickelten Kommunikation — in erster Linie mit gesprocher Sprache, Gestik und Schrift — Erkenntnisse und Ideen mit anderen Individuen ihrer Art teilen. Menschen (Homo) verfügen über komplexe soziale Strukturen, die teils aus kooperierenden, teils aus konkurrierenden Gruppen bestehen. Die Spannweite reicht im Kleinen von Familien bis zu Nationen im Großen.

Soziale Interaktionen zwischen Menschen (Homo) bestehen aus einer Vielzahl von Traditionen, Ritualen, Ethiken, Werten, sozialen Normen und Gesetzen, die zusammen die Grundlage der menschlichen Gesellschaft bilden. Menschen sind unter allen Lebewesen auf der Erde eine unverwechselbare Art, die einen besonderen Sinn für Schönheit und Ästhetik entwickelt hat, was letztlich auch zu einer hochentwickelten Kultur geführt hat. Kombiniert mit dem Wunsch nach Selbstverwirklichung und dem verhälnismäßig großen Hirnvolumen führte dies zu Innovationen wie Kunst, Schrift, Musik und Wissenschaft.
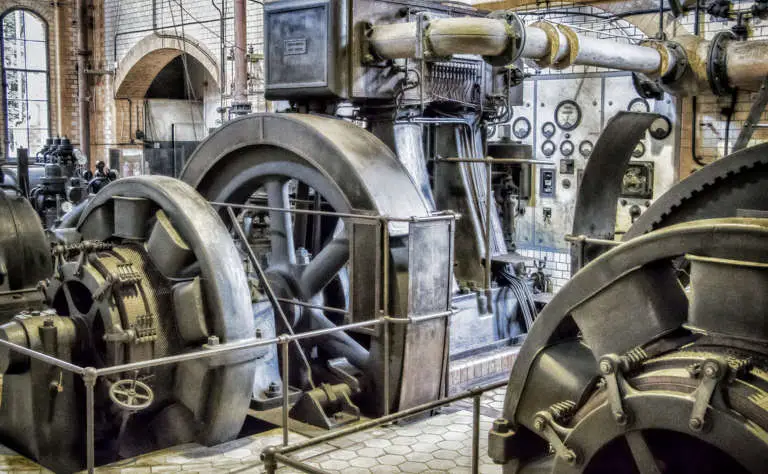
Menschen (Homo) versuchen ihre Umwelt zu beeinflussen, indem sie natürliche Phänomene durch Philosophie, Kunst, Wissenschaft, Mythologie und Religion zu erklären versuchen. Diese natürliche Neugier führte zur Entwicklung von komplizierten Werkzeugen und Fähigkeiten. Obwohl Menschen nicht die einzige Art sind, die Werkzeuge gebrauchen, so sind die Beherrschung des Feuers, das Kochen von Nahrung und das Anfertigen von Kleidung einzigartig im gesamten Tierreich. Menschen geben ihre Fähigkeiten und Kenntnisse so präzise an die nächsten Generationen weiter, dass technische Innovationen mit großem Tempo voranschreiten.
Menschen (Homo) sind eine eukaryontische Spezies. Jede Zelle des menschlichen Organismus besitzt zwei Gruppen aus 23 Chromosomen, die von jedem Elternteil vererbt werden. Es gibt 22 unspezifische Paare von Chromosomen und ein geschlechtsspezifisches Paar. Wie bei allen anderen Säugetieren wird das Geschlecht eines Menschen durch seine Chromosomen bestimmt. Frauen besitzen eine XY-Kombination, Männer eine XX-Kombination, was bedeutet, dass z.B. Erbkrankheiten, die auf dem X-Chromosom basieren (wie z.B. Hämophilie) bei Männern öfter auftreten als bei Frauen. Nach derzeitigen Schätzungen besitzt ein Mensch rund 20.000–25.000 Gene.
Systematik
Literatur
[1] Why Humans and Their Fur Parted Way by Nicholas Wade, New York Times, August 19, 2003[2] Rogers, Alan R., Iltis, David & Wooding, Stephen (2004). "Genetic variation at the MC1R locus and the time since loss of human body lang="de" hair". Current Anthropology 45 (1): 105-108. doi:10.1086/381006
[3] Jablonski, N.G. & Chaplin, G. (2000).
 The evolution of human skin coloration (pdf), 'Journal of Human Evolution 39: 57–106
The evolution of human skin coloration (pdf), 'Journal of Human Evolution 39: 57–106[4] Schwartz, Jeffrey (1987). The Red Ape: Orangutans and Human Origins. Cambridge, MA: Westview Press. pp. 286. ISBN 0813340640.